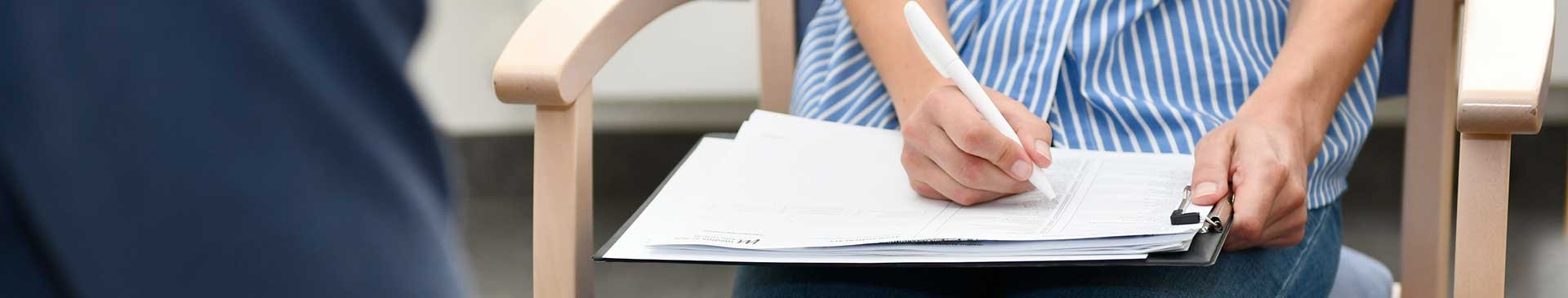Somatoforme Störungen (F4 | ICD 10)
Die Patientinnen und Patienten mit einer somatoformen Störung leiden unter körperlichen Beschwerden, suchen Ärzte auf und lassen sich wiederholt untersuchen, ohne dass sich eine hinreichende und für die Patienten befriedigende Erklärung für ihre Beschwerden finden lässt. Die Beschwerden bleiben unerklärt. Bleibende oder zunehmende Beschwerden und wiederholte Enttäuschungen darüber, dass sich keine Ursachen finden lassen, mindern die Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit der Patienten.
Das Erleben der Betroffenen
Besonders schwer für viele Patienten mit einer somatoformen Störung ist, dass sie ihre Beschwerden ganz real erleben, während Ärztinnen und Ärzte nach eingehender Untersuchung sagen: „Da ist nichts“ oder „Ihr Körper ist gesund“. Diese Aussagen können verunsichern und verletzen, weil sie im Widerspruch zum eigenen Erleben stehen. Viele Betroffene befürchten dann, dass andere denken könnten, sie bildeten sich ihre Beschwerden nur ein – oder dass sie als „psychisch krank“ abgestempelt werden.
Sinnvolle Hilfe in der Psychiatrie oder Psychotherapie
Wenn Patienten schließlich zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten kommen, fühlen sie sich teilweise missverstanden – besonders dann, wenn über ihre körperlichen Beschwerden nicht gesprochen wird.
Dabei kann gerade hier gezielte Hilfe erfolgen: Denn tatsächlich können Psychiater oder Psychotherapeuten dabei helfen, den Zusammenhang zwischen Körper und Seele besser zu verstehen und Wege zu finden, mit den Beschwerden umzugehen, sodass der Alltag wieder leichter wird.
Behandlung und Therapieansätze
In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der medius KLINIK KIRCHHEIM im Landkreis Esslingen werden somatoforme Störungen mit modernen und bewährten Methoden behandelt.
Therapiemethoden:
Verhaltensanalyse, Psychoedukation, Selbstbeobachtung, Stimuluskontrolle, Zeit- und Stressmanagement, funktionale, nicht überfordernde Tagesgestaltung, Biofeedback, Bibliotherapie, Therapie- und Zielplanung gemäß SMART
Ziel ist es, den Leidensdruck zu verringern, Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche zu fördern und einen neuen Umgang mit den Beschwerden zu finden.
So kann schrittweise wieder mehr Lebensqualität, Zuversicht und Selbstwirksamkeit entstehen.